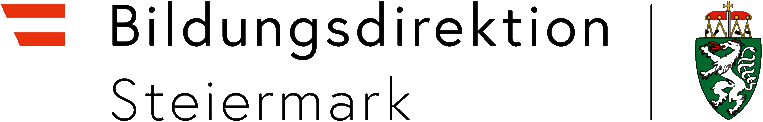Lautleseverfahren zur Förderung der Leseflüssigkeit
Lautleseverfahren sind strukturierte Methoden des Lesetrainings, bei denen Schüler/innen durch lautes oder halblautes Lesen von kurzen Texten oder Textabschnitten gezielt ihre Lesefähigkeit verbessern. Sie fördern sowohl die Leseflüssigkeit, also die Fähigkeit, zusammenhängend, rhythmisch und fehlerfrei zu lesen, als auch indirekt das Leseverstehen, da sie die automatisierte Worterkennung und die sinnvolle Verknüpfung von Wörtern im Satz- und Textkontext trainieren.
Lautleseverfahren zeichnen sich dadurch aus, dass sie explizit, wiederholt und regelmäßig durchgeführt werden. Der Fokus liegt auf dem sichtbaren Fortschritt der Lesefähigkeit durch gezielte Übungen. Zwei Hauptformen haben sich als besonders wirksam erwiesen:
1. Wiederholtes Lautlesen („Repeated Reading“)
Bei diesem Verfahren lesen leseschwache Kinder denselben Text einer geübten Leserin oder einem geübten Leser (Tutor*in oder Lehrkraft) mehrfach laut vor, bis sie eine vorher definierte Zielvorgabe erreichen, z. B. eine bestimmte Anzahl korrekt gelesener Wörter pro Minute (Leseflüssigkeitswert) bzw. flüssiges und fehlerfreies Lesen eines Absatzes. Die Vorteile:
- Automatisierte Worterkennung
- Stärkung des Sichtwortschatzes
- Verbesserung des Lesetempos und der Lesegenauigkeit
Wichtig ist die Wahl eines mittelschweren Textes (nicht zu leicht, aber auch nicht zu komplex), der nicht zu kurz ist, um bloßes Auswendiglernen durch die Wiederholung zu vermeiden. Die Fortschritte werden messbar dokumentiert, sodass beim nächsten Lautlesen ein z.B. durch Dokumentation der jeweiligen Lesezeit pro Tag), um den Fortschritt auch für die Schüler/innen sichtbar zu machen. Um die passende Leseniveaustufe auszuwählen und Schülerinnen und Schüler nicht zu über- oder unterfordern, kann die Komplexität des Textes vorab überprüft werden (Link: Ratte).
Mögliche Varianten:
- Lesetheater (Verlinken mit https://youtu.be/IGSW9FKx820)
- Vorbereitung eines Textvortrags vor der Klasse (z. B. Lieblingsbuchstelle, Radiobeitrag, Vorlesen für jüngere Kinder, Rollenlesen)
- Peer-Tutoring: Kinder üben zu zweit, wobei ein stärker lesendes Kind als Tutor fungiert.
2. Begleitendes Lesen mit einem geübten Modell („Paired Reading“)
Hier liest das Kind gemeinsam mit einem kompetenten Leser oder einen kompetenten Leserin, einem Mitschüler, einer Mitschülerin, einem Lehrer oder einer Audioquelle. Ziel ist es, durch Modellierung die richtige Lesegeschwindigkeit, Intonation und Betonung kennenzulernen und zu imitieren.
Mögliche Umsetzungen im Unterricht:
- Lese-Tandems: Ein lesestarkes Kind und ein zu förderndes Kind lesen gemeinsam:
- Synchronlesen
- Abwechselndes Lesen von Textstellen
- „Lese-Stopp“ durch den Profi: das zu fördernde Kind übernimmt das Weiterlesen
Die Tandems sollten mindestens 3× wöchentlich über einen Zeitraum von 8 Wochen für 15–20 Minuten zusammen lesen, um signifikante Fortschritte zu erzielen. Die Einteilung der Tandems sollte so passieren, dass der Unterschied zwischen den Lesepartner/innen nicht zu groß erscheint. So können ausgehend von einer Lesediagnose (z.B. durch das SLS 5-8) die Tandems so eingeteilt werden, dass die Leseränge der Schüler/innen geordnet werden und dann jeweils Tandems entstehen, die in der Leistung nicht maximal weit auseinanderliegen.
- Lehrer- oder Audio-Modell: Kinder hören über Hörbücher, TTS-Reader oder Lehrkraft einen Textabschnitt, lesen zuerst leise und dann halblaut mit und üben anschließend selbständig.
Hinweis zur Textauswahl:
Die Texte sollten dem Leistungsniveau der Kinder angepasst sein. Die Komplexität kann mit dem Lesbarkeitsindex LIX überprüft werden: https://www.psychometrica.de/lix.html
Sichtwortschatztraining - Blitzwortlesen
Das Sichtwortschatztraining zielt darauf ab, häufig vorkommende Wörter (z. B. aus dem Grund- oder Fachwortschatz) automatisiert und schnell zu erkennen, ohne sie jedes Mal neu erlesen zu müssen. Dies entlastet den Leseprozess erheblich und erhöht die Lesegeschwindigkeit.
Methodischer Ablauf:
1. Einführung der Wörter mit Wortkarten:
- Wort wird gezeigt und (gemeinsam) gelesen.
2. Blitzlesen:
- Wörter werden für 1–2 Sekunden eingeblendet.
- Ziel ist das schnelle, ganzheitliche Erfassen.
- Mehrfache Wiederholung zur Festigung.
3. Einbettung in Kontexte:
- Wörter werden in Sätze eingebaut.
- Wiedererkennen der bekannten Wörter im Textzusammenhang.
4. Spielerische Wiederholung:
- Memory, Domino, digitale Tools, z. B. Apps zum schnellen Worterkennen.
- Regelmäßige Wiederholungen zur Sicherung im Langzeitgedächtnis.
Ziel:
Wörter sollen nicht mehr lautierend gelesen, sondern direkt visuell erkannt und verstanden werden.
Vielleseverfahren
Vielleseverfahren fördern Lesemotivation und Lesequantität, indem sie Schülerinnen und Schülern viel Zeit zum selbstbestimmten Lesen einräumen. Das Ziel ist, dass Kinder durch regelmäßige Lektüre eigener Wahl mehr Routine im Lesen entwickeln und dadurch ihre Lesefähigkeit auf natürliche Weise verbessern.
Mögliche Umsetzung im Unterricht:
- Lesezeit im Schulalltag verankern
(Leseleiste: täglich lesen alle Schüler*innen 15 Minuten am Tagesbeginn oder nach der großen Pause) - Leseolympiade
- Kinder lesen und dokumentieren dies im Lesepass.
- Monatlich erfasst die Lehrperson die Lesegeschwindigkeit.
- Am Ende Prämierung besonders aktiver Leser*innen.
- Unterstütztes eigenständiges Lesen
- Während die Klasse ca. 20 Minuten leise liest, führt die Lehrkraft mit einzelnen Kindern eine Lesekonferenz (ca. 5 Minuten) durch. Dabei kommt es zu Erhebung der Leseflüssigkeit über ein Lautleseprotokoll.
- Auch ein kurzes Gespräch zum Inhalt der Leselektüre kann eingebaut werden.
- Die Lehrperson gibt individuell Rückmeldungen und informiert über passende Lesestrategien.
- Ziel: Jeder Schülerin erhält wöchentlich individuelle Rückmeldung.