Dr. techn. Dipl. Ing. Florian Aigner (www.florianaigner.at): „Planetary Health Diet“
Wie reden wir über Wissenschaft?
Österreich hat ein Problem: Kaum ein anderes Land in Europa ist so desinteressiert an Wissenschaft. Das ist unerfreulich, auch in Hinblick auf Zukunftschancen für unsere Wirtschaft und unseren persönlichen Wohlstand. Aber warum ist es so schwierig, in der breiten Bevölkerung Begeisterung für Wissenschaft zu entfachen? Welche Fehler werden dabei gemacht - auch in seriösen Medien? Entscheidend dabei ist Ehrlichkeit. Weder durch Aufbauschen von Gefahren noch durch Übertreiben von Vorteilen kann man für Vertrauen in die Wissenschaft sorgen.
Univ.-Prof. Dr. Christoph Bock (Meduni Wien):
„Artificial Intelligence in Biologie und Medizin“
Artificial Intelligence (AI) hat großes Potenzial, zu einer personalisierten, datengesteuerten Zukunft der Medizin beizutragen, die auf einem biologischen Verständnis von Krankheiten und Therapien basiert. Zum Bespiel tragen leistungsfähige Methoden zur Analyse des Genoms zu präzisen Diagnosen und Therapieentscheidungen bei Krebs und seltenen genetischen Erkrankungen bei. Ich werde die Herausforderungen und Chancen der Einbindung von AI-Methoden in die biomedizinische Forschung und in die klinische Routine diskutieren, insbesondere im Kontext von Genetik und Epigenetik sowie der Entwicklung von personalisierten Zelltherapien.
Ass.-Prof. Dr. paed. Philipp Spitzer (Universität Graz):
„Schmelzende Gletscher, große Fußabdrücke und Sodawasser als Rettung? – Ideen zur Umsetzung von Bildung für nachhaltiger Entwicklung im Unterricht“
Gletscher sind nicht nur beeindruckende Naturphänomene, sondern auch eindrucksvolle und gut sichtbare Zeugnisse des Klimawandels. Obwohl sie gerade in letzter Zeit immer wieder in den Medien präsent sind, ist das Wissen über Gletscher und alpine Regionen bei vielen Schülern begrenzt und oft von Missverständnissen geprägt. Gleichzeitig stellen sie sich jedoch auch die Frage, welche Auswirkungen der Rückgang der Gletscher und allgemein der klimatische Wandel hat. In ihrem Alltag treffen sie auf klimaneutrale Produkte, der Forderung nach der Reduktion des eigenen Carbonfootprints und der Speicherung von Kohlenstoffdioxid in Form von Carbon Capture and Storage (CCS). Aber wie kann ich den Carbon Footprint in der Klasse diskutieren und Carbon Capture auch in Experimenten auf dem Grund gehen?
Ausgehend von dem Phänomen der Gletscher gibt der Vortrag Einblicke in Umweltfolgen des Klimawandels im Gebirge und polaren Regionen. Untermauert von einfachen Experimenten werden diese Phänomene für den Unterricht aufbereitet. Ausgehend vom Phänomen der Gletscherabflüsse als natürliche Kohlenstoffdioxidsenke werden zudem die Thematik des Carbon Capture sowie der Reduktion des eigenen CO2-Fußabdrucks zur Diskussion für Schüler/innen aufbereitet.
MMag.a Dr.in Elke Höfler (Universität Graz):
„Künstliche Intelligenz im Bildungssystem: ein Blick in Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft“
Künstliche Intelligenz (KI) hat das Potenzial, das Bildungssystem grundlegend zu verändern. Doch wie hat sich die Rolle von KI in der Bildung entwickelt, wo stehen wir heute und welche zukünftigen Entwicklungen sind zu erwarten? In dieser Keynote werfen wir einen Blick zurück auf die Anfänge von KI in der Bildung, beleuchten aktuelle Einsatzmöglichkeiten und wagen einen Ausblick auf zukünftige Trends und Innovationen. Dabei werden Chancen und Herausforderungen diskutiert, die mit der Integration von KI in Schulen und Hochschulen verbunden sind. Die Keynote versteht sich als Brainsnack to go für alle, die sich mit der Zukunft der Bildung beschäftigen.
Univ.-Prof. Dr. Anja Lembens (AECC Chemie, Universität Wien):
Workshop „Ideen zur Integration von grüner Chemie in den Chemieunterricht der Sekundarstufe II“
Univ.-Prof. Dr. Anja Lembens und Alexandra Teplá, BEd BSc. MEd
Wir sind derzeit mit Klimawandel, Umweltverschmutzung und gesundheitlichen Problemen auf unserem Planeten konfrontiert, die unter anderem durch vom Menschen verbreitete Stoffe und Produkte verursacht werden. In Anbetracht dieser Herausforderungen ist es notwendig, dass jede/r Einzelne über eine angemessene naturwissenschaftliche Grundbildung verfügt, um informiert und nachhaltig mit (chemischen) Produkten umzugehen.
Einerseits ist es die Aufgabe der chemischen Industrie, sichere Stoffe und nachhaltigere Herstellungsverfahren zu entwickeln. Durch Berücksichtigung von Prinzipien der grünen und nachhaltigen Chemie in der chemischen Industrie und Forschung kann ein wesentlicher Beitrag zur Bewältigung dieser Herausforderung geleistet werden. Andererseits muss jede/r Einzelne über das Wissen und die Fähigkeiten verfügen, um sachkundig, nachhaltig und verantwortungsbewusst zu handeln, denn wenn die Produkte einmal hergestellt sind, liegt es in Händen der Verbraucher/innen, wie sie die Produkte verwenden und entsorgen. Hierzu kann und muss der Chemieunterricht einen Beitrag leisten.
Im Workshop werden Einblicke in das Konzept der grünen und nachhaltigen Chemie gegeben und Ideen vorgestellt, wie Schüler/innen der Sek II ihr Bewusstsein für nachhaltiges Handeln schärfen und Bewertungskompetenzen in Bezug auf Themen mit Nachhaltigkeitsaspekten erwerben können. Die Teilnehmer/innen können ausgewählte Versuche selbstständig durchführen und erhalten einen geführten Zugang zu digitalen Lerngelegenheiten auf spottingscience-vienna.at sowie zu den begleitenden Unterrichtsmaterialien, so dass sie diese leicht für ihren eigenen Chemieunterricht nutzen können.
Mag. Dr. Andreas Windisch (Joanneum Research): "KI: Von Vision zu Realität"
In den letzten zehn Jahren haben wir bemerkenswerte Durchbrüche auf dem Gebiet des maschinellen Lernens und des Deep Learning erlebt, die zu der Entwicklung von extrem leistungsstarken Sprachmodellen geführt haben. In diesem allgemeinen Vortrag möchte ich Sie alle dazu einladen, gemeinsam einige der Höhepunkte dieser aufregenden Entwicklungen zu betrachten, die zu den KI-Modellen geführt haben, die wir heute verwenden. Ziel des Vortrags ist es, ein Verständnis für den aktuellen Stand der Technik und ihre möglichen Auswirkungen auf die Gesellschaft als Ganzes zu vermitteln. Ich freue mich darauf, mit Ihnen zu diskutieren!
Univ.-Prof. Dr. Helmut Jungwirth (Uni Graz): "Was kann man vom Kabarett und von Social Media für die Wissensvermittlung lernen?"
In diesem Vortrag geht es darum, dass Wissenschaftskommunikation ein sehr vielschichtiges System ist, das neben dem wissenschaftlichen Inhalt und dem Format, vor allem auch jene Personen umfasst, die als Kommunikator*innen fungieren. Es geht es um die Rolle des Erzählens von Geschichten, den Humor, Emotionen und darum, dass wir Zielgruppen nicht nur mit wissenschaftlichen Fakten erreichen. Aber wie gelingt ein informativer Zugang zur Wissenschaft mittels humorvollem Geschichtenerzählen und welche kommunikativen und konzeptionellen Strategien kommen hier zum Tragen?
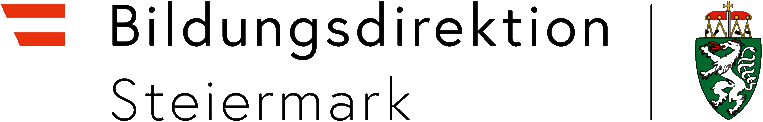

.jpg)


.jpg)

